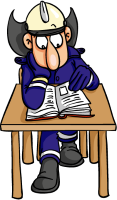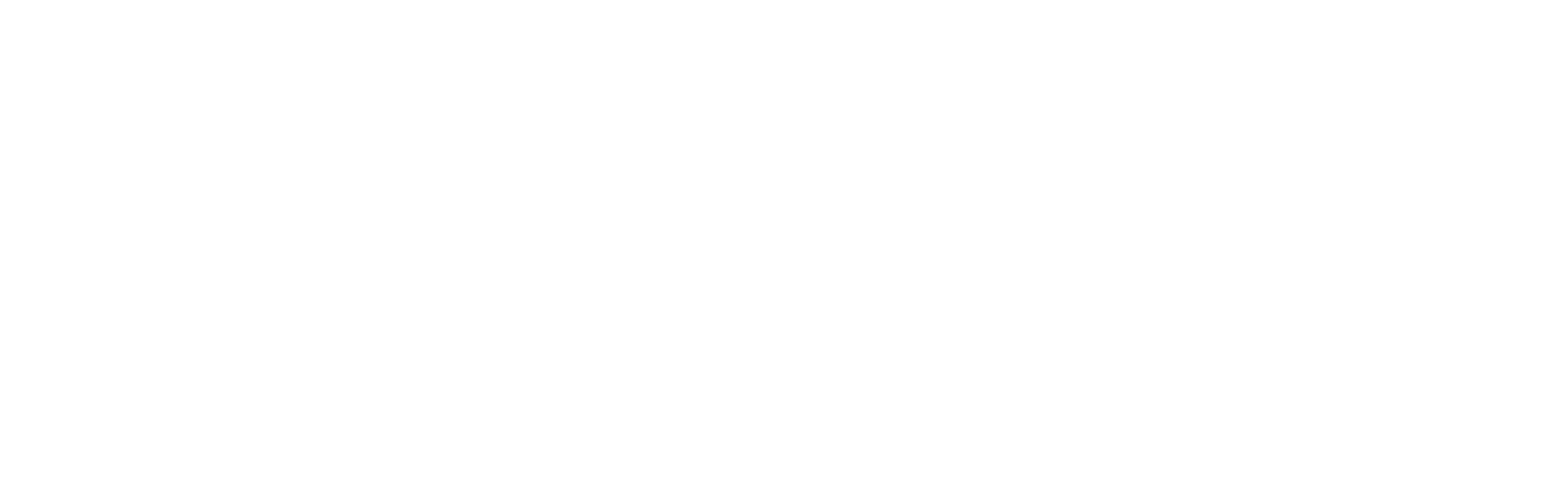Gluck, Gluck, Gluck, weg ist der Schwimmer!
Im Jahr 2018 sind in Deutschland mindestens 504 Menschen ertrunken. 435 Männer und Frauen, das sind rund 86 % der Opfer, verloren in Flüssen, Bächen, Seen und Kanälen ihr Leben. „Binnengewässer sind nach wie vor die Gefahrenquelle Nummer eins. Nur vergleichsweise wenige Gewässerstellen werden von Rettungsschwimmern bewacht. Das Risiko, an unbewachten Seen und Flüssen zu ertrinken, ist auch deshalb um ein Vielfaches höher als an Küsten oder in Schwimmbädern“, beschreibt Achim Haag, Präsident der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG), die Gefahrenlage.
„Leichtsinn, Übermut und Unkenntnis über Gefahren spielen dabei eine große Rolle“, sagt DLRG-Sprecher Achim Wiese zu der hohen Zahl männlicher Ertrunkener. Senioren gehe schnell die Kraft aus, Herzprobleme oder Diabetes seien ebenfalls oft ein Problem.
Weitere Informationen zur DLRG Ertrinkungsstatistik der letzten Jahre finden Sie hier.
Doch was haben die Ertrinkungstoten mit der Feuerwehr zu tun? Es kommt immer wieder vor, dass die Feuerwehr mit ihrer Ausrüstung und Personal unterstützt, wenn Mitbürger in einem Gewässer vermisst werden oder sie zu einem medizinischen Notfall hinzugezogen wird.

10 Baderegeln der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft
Von den 10 Baderegeln des DLRG haben bestimmt die meisten schon mal gehört, die wir mit anschaulichen Grafiken und den Baderegeln als Überschrift dargestellt haben.
Doch was sind die Gründe für die Baderegeln? Dies haben wir zusätzlich noch einmal versucht zu erläutern, um die Wichtigkeit zu veranschaulichen.
Veröffentlichung der Grafiken mit freundlicher Genehmigung des DLRG. Die Baderegeln hier noch einmal als Download.
Gehe nur zum Baden, wenn du dich wohl fühlst. Kühle dich ab und dusche, bevor du ins Wasser gehst.

Wer ins Wasser gehen möchte, sollte gesund sein und sich wohl fühlen. Vor allem mit Erkältung, Ohrentzündung oder auch bei allgemeinem Unwohlsein sollte man auf ein Bad verzichten. Auch der Magen sollte weder komplett leer noch zu voll sein.
Das Badewasser ist meist kühler als die Körpertemperatur, daher muss der Körper erst langsam an den Temperaturunterschied gewöhnt werden. Dies kann durch eine kühle Dusche geschehen oder indem man langsam in das Wasser hinein watet und Arme sowie Oberkörper mit einigen Handvoll Wasser abkühlt.
Ohne Duschen gelangt jeglicher Schmutz, der sich auf der Haut befindet, ins Wasser. Dies können z. B. Schweiß, Körperflüssigkeiten, Körperausscheidungen, Cremes, Öle, etc. sein die sich auf der Haut befinden. Denken Sie also daran: Mit der Dusche vor dem Schwimmen tun Sie nicht nur sich selbst einen Gefallen, sondern auch den anderen Schwimmgästen.
Gehe niemals mit vollem oder ganz leerem Magen ins Wasser.

Eine alte Regel besagt, dass man nach dem Essen nicht gleich schwimmen gehen sollte. Richtig ist: Weder mit ganz vollem noch mit ganz leerem Magen sollte man baden gehen.
Der Magen-Darmtrakt ist nach dem Essen mit der Verdauung beschäftigt und benötigt dafür mehr Blut, wodurch es im Körper zu einer Blutumverteilung kommt. Die Blutversorgung der Muskeln und des Gehirns ist entsprechend geringer und der Körper ist weniger leistungsstark.
Abhängig vom Gericht braucht das Essen ca. 30 bis 60 Minuten, bis es den Magen passiert hat und im Darm angekommen ist. Wer trotzdem vor dem Schwimmen eine Mahlzeit zu sich nimmt, bei dem kann leicht zu Bauchschmerzen oder Übelkeit kommen, da das Wasser auf den vollen Bauch beim Schwimmen drückt.
Bei Kindern kommt hinzu, dass diese beim Spielen und Planschen gerne einmal Wasser schlucken. In Kombination mit dem vollen Magen kann ihnen dadurch schnell übel werden.
Wer unter Herz- und Kreislaufproblemen leidet sollte auf keinen Fall mit vollem Magen schwimmen gehen. Die doppelte Belastung durch Verdauungsarbeit und sportlicher Aktivität kann tatsächlich unter anderem Kreislaufversagen hervorrufen.
Auch Schwimmen mit leerem Magen ist nicht empfehlenswert. Hunger in Kombination mit anstrengenden Leistungen kann eine Unterzuckerung auslösen.
Gehe als Nichtschwimmer nur bis zum Bauch ins Wasser.

Natürlich möchten auch Kinder die noch nicht schwimmen können im Wasser planschen.
Wer nicht schwimmen oder sich nur für sehr kurze Zeit alleine über Wasser halten kann, darf nur bis zum Bauch und maximal bis Schulterhöhe ins Wasser.
Bei kleineren Kindern ist der Kopf größer als der Körperrumpf und das Gleichgewichtsorgan noch nicht ganz so ausgeprägt. Dadurch kann es bei einem Stolpern passieren, dass der Kopf unter Wasser geht und dadurch das Kind selbst im flachen Wasser schnell ertrinkt.
Erwachsene, die Nichtschwimmer sind, überschätzen sich schnell. In Deutschland ist der Schwimmunterricht in den meisten Fällen Bestandteil der Schulbildung, was im Ausland nicht immer der Fall ist, daher gibt es gerade unter den Flüchtlingen mehr Nichtschwimmer.
Aufblasbare Schwimmhilfen wie Schwimmflügel und -ringe, Luftmatratzen oder ähnliches bieten keine ausreichende Sicherheit, wenn ihr in tiefem Wasser seid.
Rufe nie um Hilfe, wenn du nicht wirklich in Gefahr bist, aber hilf anderen, wenn sie Hilfe brauchen.

Gerade bei Kindern kommt der Hilferuf aus Spaß häufiger vor. Wer zu oft aus Spaß um Hilfe ruft wird irgendwann vielleicht nicht mehr ernst genommen. Im Ernstfall ist oft schwer einschätzen ob es sich wieder um einen Spaßhilferuf oder nun wirklich um einen Notfall handelt.
Des Weiteren bringt sich ein Retter bei einem unnötigen Hilferuf vielleicht selber in Gefahr, ohne dass es überhaupt einen ernsthaften Anlass gibt.
Überschätze dich und deine Kraft nicht.

Wer sich zu sehr beim Schwimmen verausgabt, kommt in die Gefahr, den Rückweg nicht mehr zu schaffen.
Das Wasser ist kein Ort für Mutproben und übertriebenen Ehrgeiz. Bist du weit weg vom Ufer und wirst durch Überanstrengung kraftlos, kann dies zum Ertrinken führen.
Es kann zu einem Krampf während des Schwimmens in den Waden oder Fußzehen kommen, welcher viele Ursachen haben kann. Ungewohnte Belastungssteigerungen haben Auswirkungen auf den Mineralhaushalt, die sich z. B. in einem Magnesiummangel äußern können. Auch plötzliche Bewegungen können schnell Krämpfe verursachen. Wenn man zu diesem Zeitpunkt zu weit vom Ufer entfernt ist und keine Hilfe sich in der Nähe befindet dann kann sich dies zu einem ernsthaften Problem entwickeln.
Bade nie alleine und schwimme lange Strecken nie ohne Bootsbegleitung!
Bade nicht dort, wo Schiffe und Boote fahren.

Bootsführer können Schwimmer, bei denen ja nur der Kopf aus dem Wasser schaut, meist sehr schwer oder erst zu spät erkennen. Anders als bei Auto kann ein Boot/Schiff nicht sehr schnell anhalten oder die Richtung ändern.
Es besteht die Gefahr in das Fahrwasser der Schiffe gezogen zu werden. Ein Zusammenstoß mit einem Boot/Schiff kann ernsthafte Folgen haben, denn gefährliche Schiffsschrauben, Motoren und andere bewegliche Teile liegen unter Wasser und sind vom Schwimmer nicht sichtbar. Diese können zu schweren Verletzung oder sogar zum Tode führen.
Beachte Warnhinweise, Begrenzungen, Absperrungen und Bojen. Hinweisschilder die auf ein Badeverbot hinweisen sind unbedingt zu einzuhalten, bade nur in erlaubten Bereichen!
Bei Gewitter ist Baden lebensgefährlich. Verlasse das Wasser sofort und suche ein festes Gebäude auf.

Gewitter sind sehr schwer einschätzbar und unvorhersehbar. Sicher ist man nur in festen Gebäuden, oder wenn keines in der Nähe ist da man unterwegs ist im Auto.
Allseits ist bekannt, dass der Blitz bei einem Gewitter meist in den höchsten Punkt einschlägt. Doch wie sieht dies beim Schwimmen im Wasser aus? Die Möglichkeit, beim Schwimmen vom Blitz getroffen zu werden ist um ein Vielfaches höher als an Land. Da beim Schwimmen der Kopf aus dem Wasser ragt ist dort die Wahrscheinlichkeit vom Blitz getroffen zu werden sehr groß.
Die enorme Energie des Blitzes kann hierbei zu sehr schweren Verbrennungen, Gewebe- und Nervenschädigungen, Atemlähmungen und Herzstillstand führen. Es spielt keine Rolle ob man sich im Schwimmbecken, Pool, offenen Gewässer Fluss/See/Meer oder ähnlichem befindet, Baden bei Gewitter ist höchst lebensgefährlich!
Halte das Wasser und seine Umgebung sauber, wirf Abfälle in den Mülleimer.

Abfall gehört immer in den dafür vorgesehen Mülleimer! Ist im Moment keiner in Reichweite ist der Müll wieder mitzunehmen und kann im nächstgelegen Abfalleimer entsorgt werden.
Bei Glas kann es bei Scherbenbildung ganz schnell zu Verletzungen kommen. Glasscherben sowie auch zurückgelassene Asche vom Grillen führen häufig zu Flächenbränden. Plastiktüten und andere Kunststoffteile werden leicht ins Wasser geweht. Sie sind biologisch kaum abbaubar, sammeln sich zu großen Mengen an und gefährden die Tier- sowie Pflanzenwelt.
Müll ist einfach nur eklig und ein gefundenes Fressen für Ratten.
Aufblasbare Schwimmhilfen bieten dir keine Sicherheit im Wasser.

Aufblasbare Schwimmhilfen wie Luftmatratzen, Schwimmreifen etc. bieten aufgrund ihrer Instabilität keine große Sicherheit.
Man kann z. B. mit einer Luftmatratze sehr schnell umkippen. Wenn man sich nahe am Ufer oder seichtem Wasser befindet ist dies ja meist nicht das Problem, anders sieht dies jedoch aus wenn man sich weiter entfernt und im tieferen Wasser befindet, gerade dann wenn die Schwimmfähigkeiten nicht die besten sind und man nicht mehr auf die Luftmatratze rauf kommt. Wenn man mit der Luftmatratze rauspaddelt überschätzt man sich dabei leicht. Gerade dann wenn man von der Strömung abgetrieben und dann den Rückweg nicht mehr schafft.
Springe nur ins Wasser, wenn es frei und tief genug ist.

Wenn das Wasser zu flach ist, kann es schnell zu einem erhöhten Verletzungsrisiko kommen, gerade Wirbelsäulen- oder Kopfverletzungen kommen dabei häufiger vor. Daher ist ein Sprung ins Wasser erst ab einer Wassertiefe von mind. 1,5 Tiefe zu empfehlen.
Springe nie in unbekanntes oder trübes Wasser. Abgesehen von der unbekannten Wassertiefe könnten darin z. B. Äste liegen an denen man sich verletzen kann.
Gefährde niemanden durch einen Sprung ins Wasser, schwimme oder tauche nie im Bereich von Sprunganlagen!
Weitere wichtige Baderegeln
Neben der DLRG weisen z. B. auch die Wasserwacht des DRK, Krankenkassen und Versicherungen auf Baderegeln hin, die bisher noch nicht aufgeführt wurden, aber auch genannt werden müssen.
Gehe nicht unter Alkohol-, Drogen- oder Medikamenteneinfluss ins Wasser.

Unter Alkohol kommt es sehr schnell zu Fehleinschätzungen der eigenen Fähigkeiten und die Koordination und Wahrnehmung wird schon durch geringe Alkoholkonzentrationen beeinträchtigt. Zudem drohen beim Gang ins kalte Wasser starke Kreislaufprobleme bis hin zu einem Kreislaufkollaps aufgrund einer Unterkühlung, die bereits bei 20 bis 22 Grad Wassertemperatur einsetzen kann.
Wie allseits bekannt wirken Drogen auf den Mensch berauschend und verursachen somit die gleichen Probleme wie Alkohol. Auch gewisse Medikamente können berauschend wirken, beachten Sie daher bitte den Beipackzettel auf solche Hinweise!
Bewachsene und sumpfige Wasserbereiche sind gefährlich.

Schwimmen im Wasser mit stark bewachsene Unterwasserpflanzen sollte man vermeiden. Sie sind an sich nicht gefährlich, sondern nur dann wenn sich der Schwimmer darin verheddert und in Panik gerät.
Wer wild um sich schlägt oder mit den Beinen strampelt, verfängt sich womöglich noch mehr in der Pflanze. Kommt man nun doch in eine solche Situation sollte man versuchen Ruhe zu bewahren und die Pflanzen vom Bein oder von den Armen einfach abzustreifen. Danach möglichst flach aufs Wasser legen und mit leichten Paddelbewegungen aus dem Bereich schwimmen, so verhindert man ein erneutes Verfangen in den Pflanzen.
Wenn das Abstreifen aus eigener Kraft nicht möglich ist, sollten Schwimmer laut um Hilfe rufen und andere Badegäste oder Rettungsschwimmer auf sich aufmerksam machen.
Meide Wehre und Strudel.

Strudel entstehen, wenn sich das fallende Wasser hinter den meist künstlichen Flusswehren in den Flussboden gräbt und dabei in Rotation versetzt wird. Die so entstehenden Strudel ziehen den Schwimmer in die Tiefe. Je größer die Fallgeschwindigkeiten des Wassers hinter den Wehren, desto tiefer sind solche Gräben und desto stärker wird der Strudel. Der gefangene Schwimmer wird deshalb bei dem Versuch, die Wasseroberfläche zu erreichen, immer wieder nach unten gedrückt und ertrinkt.
Selbst das Schwimmen in der Nähe von relativ kleinen Flusswehren bleibt aber gefährlich. Jedes Flusswehr hat einen anderen Gefahrenbereich und die Stärke der Strömung ist auch vom Wasserstand abhängig.
Beachte besondere Gefahren am und im Meer.

In unbekannten Gewässern ist es ratsam sich vor dem Baden über die Gefahren zu informieren. Hier ein paar Beispiele:
Die häufigsten Verletzungen durch Giftfische werden im Strandbereich durch Weber- oder Drachenfische und Stech- oder Stachelrochen verursacht. Hier hilft das Tragen von Badeschuhen oder auch ein schlurfender Gang über den Meeresboden, wodurch diese Fische im Vorfeld verscheucht werden.
Quallen gehören zu den giftigsten Meeresbewohnern überhaupt. Quallen und andere Nesseltiere an den Stränden Europas sind oft ungefährlich. Doch es gibt auch giftige Arten, denen Badegäste und Schwimmer aus dem Weg gehen sollten. Bei Kontakt können sie mit ihrem Gift für starke Verbrennungen, offene Wunden, Übelkeit, Erbrechen, Atemstillstand und im schlimmsten Fall einem Herz-Kreislauf-Versagen sorgen. Bei den ersten Anzeichen für einen Kontakt mit einer giftigen Qualle einem Arzt vorstellen!
Seeigel erfreuen sich nicht gerade großer Beliebtheit. Wer schon einmal auf einen getreten ist, weiß dass die Stacheln eines Seeigels Schmerzen verursachen können. Verletzungen mit Seeigeln kommen an allen Stränden der Welt vor. Die mit Widerhaken ausgerüsteten Stacheln dringen tief in die Haut ein und lösen sehr schmerzhafte Entzündungsreaktionen aus. Wenn Sie in einen Seeigel getreten sind, entfernen Sie die Stacheln unverzüglich. Versuchen Sie, den aus Kalk bestehenden Stachel mit Essig aufzulösen. Oder kleben Sie mehrfach ein Klebeband darauf und ziehen Sie es ab. Es gibt sogar Seeigel, die mit ihren Stacheln Gift spritzen, wie mit einer Nadel.
Haiangriffe sind sehr selten. Dennoch ziehen einige Strände sie aus verschiedenen Gründen wie magisch an. Die drei Haie, die am wahrscheinlichsten einen Menschen angreifen, sind laut dem Portal Travel and Leisure die Bullenhaie, Weiße Haie und Tigerhaie. Große Weiße Haie verbringen die meiste Zeit im offenen Ozean. Bullenhaie sind dagegen in Flussdeltas unterwegs und nähern sich bis zu etwa 90 Kilometer der Küste. Tigerhaie sind äußerst neugierig. Sie ernähren sich eigentlich von Aas, Schildkröten und Müll, könnten aber aus ihrem Erkundungssinn heraus einen Menschen beißen. Nie alleine im offenen Meer schwimmen. Bei einem Haiangriff versuchen mit wiederholten harten Schlägen auf die Augen oder Kiemen zu zielen - nicht auf die Nase!
Im Schwimmbad ist es glatt, gehe langsam, es wird nicht gerannt.

Im Schwimmbad sind die Böden meistens durch das Wasser etwas rutschig.
Schnell ist es geschehen, dass man auf dem nassen Boden ausrutscht und das Gleichgewicht verliert. Beim Sturz auf den harten Fliesenboden sind ernsthafte Verletzungen nicht auszuschließen.
Verlasse das Wasser sofort wenn du frierst! Trockne dich nach dem Baden gut ab und ziehe trockene Kleidung an.

Durch die im Vergleich zur Luft- in der Regel viel niedrigere Wassertemperatur geben wir ständig Wärme ab, um zumindest die Körperkerntemperatur halten zu können.
Es kann zu einer Unterkühlung kommen, da der Körper mehr Wärme verliert als er nachproduzieren kann. Oft tritt dann als erste Reaktion das sogenannte Kältezittern auf. Dieses Zittern dient eigentlich dazu, dass wir uns durch die Mini-Muskelkontraktionen bewegen und der Körper somit Wärme produziert. Eine Schutzreaktion, denn langanhaltende Unterkühlung kann zu Gesundheitsschäden oder sogar zum Tod führen.
Schütze dich bei starker Sonne, halte dich im Schatten auf.

Ein Sonnenstich entsteht, wenn Kopf und Nacken zu lange direkter Sonne ausgesetzt sind. Dabei staut sich die Hitze im Kopf und führt zu einer Reizung der Hirnhäute. Diese können sich dann entzünden und eine Gehirnschwellung verursachen. Mögliche Symptome eines Sonnenstichs sind Kopfschmerzen, Übelkeit, Erbrechen, Schwindel oder ein steifer Nacken. Auch der Kopf kann rot und heiß werden, während der Körper kühl bleibt. In diesem Fall sollten Betroffene schnell aus der Sonne gehen, den Kopf kühlen und viel trinken. Im Zweifel den Rettungsdienst verständigen oder einen Arzt aufsuchen.
Ein Sonnenbrand ist eine durch UV-Strahlung verursachte Verbrennung der Haut ersten oder zweiten Grades. Die betroffenen Hautstellen sind gerötet, jucken und es treten häufig auch Schmerzen auf. Beim dritten Grad kommt es zu einer Blasenbildung der Haut. Jeder Sonnenbrand beschleunigt die Hautalterung und erhöht langfristig das Risiko an Hautkrebs zu erkranken. Daher auch vor dem schwimmen gehen mit einer wasserfesten Sonnencreme eincremen und die Anwendung wiederholen. Der Lichtschutzfaktor der Sonnencreme ist der Hautempfindlichkeit anzupassen.
Nimm Rücksicht auf andere, besonders auf Kinder und ältere Menschen. Tauche andere nicht unter und stoße nicht andere beim Spielen ins Wasser.

Diese Baderegel hat etwas mit Anstand sowie Respekt gegenüber seinen Mitmenschen zu tun und sollte eine Selbstverständlichkeit sein, daher bedarf es hierzu keine weiteren Erläuterungen!
Videos